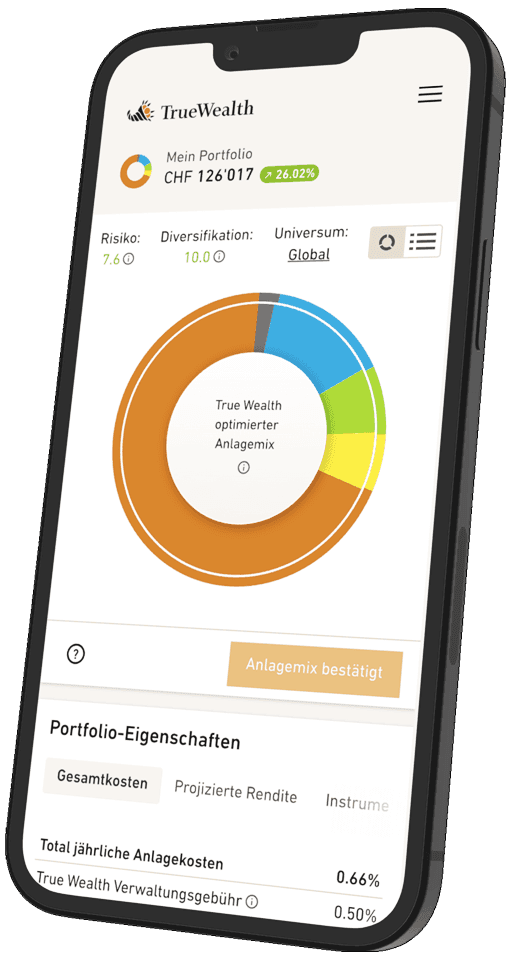Inflation: Die Steuer, die niemand zahlen will
Inflation nagt an Einkommen und Vermögen, wie eine Steuer. Sie ist die Steuer, die wir nie demokratisch beschlossen haben – die aber trotzdem jemand zahlen muss.
Wenn Sie Vermögen haben, dann sehen Sie die Kaufkraft schrumpfen. Die Inflation nagt daran. Für die meisten Menschen ist das keine Frage von Leben oder Tod. Aber sehr wohl eine Frage des Lebensstandards. Die Grundbedürfnisse können sie weiterhin decken. Aber werden Sie sich nächstes Jahr noch Ferien leisten können, wie Sie sie vor der Pandemie gemacht haben? Liegt ein neues Elektroauto drin – oder muss der Benziner noch ein paar Jahre durchhalten?
Inflation trifft nicht nur die Vermögenden. Sie trifft jeden auf seine Weise. Wer von einer kleinen Rente lebt, hat sich vielleicht schon vorher kein frisches Gemüse geleistet, steigt jetzt um auf die billigste Pasta – und kann vielleicht morgen seine Miete nicht mehr zahlen. Wer sich in Ägypten schon vor der Inflation sein Brot fast nicht leisten konnte, der muss vielleicht bald hungern. Die Weizenpreise explodieren – und die Löhne halten nicht Schritt.
In der Inflation verlieren alle: Von Menschen mit ein wenig Vermögen, die sich eben noch für wohlhabend gehalten haben. Bis hin zu den Armen, von denen man glaubte, sie hätten gar nichts mehr zu verlieren.
In Zeiten der Inflation gewinnen – das gelingt vor allem Menschen, die hohe Schulden haben, etwa eine Hypothek. Nagt die Inflation am Nennwert der Hypothek und behält die Immobilie ihren Wert, dann wächst das Vermögen. Wer auf so eine Art und Weise gewinnt, sollte sich allerdings nicht zu früh freuen. Manchmal schöpfen Staaten den Gewinn gleich wieder ab. Deutschland hat das zweimal getan: Ab 1924 mit der Hauszinssteuer. Und ab 1952 mit der Lastenausgleichsabgabe.
So gesehen: Um Gewinn geht es gar nicht in Phasen der Inflation. Für die meisten Menschen mit Vermögen ist das Ziel vor allem, den Verfall aufzuhalten. Professionelle Verwaltung kann dabei helfen – und zum Glück ist in der digitalen Welt Vermögensverwaltung für viele zahlbar.
Inflation wirkt wie eine zusätzliche Einkommens- und Vermögenssteuer – für uns persönlich. Aber hat der Staat wirklich einen Vorteil daraus?
Klar, wenn der Staat Schulden hat, dann führt Inflation auf den ersten Blick zum selben Ergebnis wie neue Steuern. Denn: Mit dem Verlust des Geldwertes entwerten sich auch die Schulden des Staates. Je mehr Schulden, und je mehr sie an Wert verlieren, desto besser für die Staatskasse.
Viele Ökonomen sagen darum: Inflation ist im Grunde eine Steuer. Jemand muss zahlen für das, was der Staat ausgibt. Klingt logisch. Allerdings ist es eine demokratisch nicht legitimierte Steuer, und sie führt zu massiven Kollateralschäden. Und sie ist nicht einmal fair, um das Modewort zu gebrauchen.
Es stellen sich folgende Fragen.
Wer muss zahlen: alle gleichermassen – oder die Reichen besonders stark? Wann wird gezahlt: zeitgleich mit den Staatsausgaben – oder viel später? Und wer bestimmt, wie gezahlt wird: Die Bürger und ihre Volksvertreter in einem demokratischen Prozess?
Wenn wir uns nicht politisch auf die Steuer einigen, dann holt uns eben die Inflation ein. Mit der Geldentwertung werden dann die Steuern bezahlt, die niemand zahlen wollte.
Kann man also sagen: Inflation ist gewollt? Und, falls ja, wer will sie? Oder ist Inflation einfach so passiert, und wir wissen nur noch nicht so genau, was dagegen tun?
Eines aber ist keine Frage mehr. Haben wir Inflation?
Ja. Wir haben.
Wie hoch ist die Inflation im August 2022?
Die neuesten Zahlen heute stammen aus dem August 2022. Dabei sehen wir: Die Lebenshaltungskosten in der Schweiz sind in den letzten Monaten stetig angestiegen. Im Juli 2022 stiegen die Verbraucherpreise im Vergleich zum Vorjahr um 3,4 Prozent. Mit diesen Werten können die Preise in der Schweiz fast noch als stabil gelten.
Die Schweiz ist dabei mit 3,4% Preissteigerung weiterhin eine Insel der Glückseeligen: Die Verbraucherpreise in Deutschland stiegen im August 2022 um 8,9 Prozent im Vergleich und in den USA um 8,5 Prozent zum Vorjahr. Im Juli 2022 hatte die Inflationsrate in den USA sogar noch höher gelegen, bei 9.0 Prozent. Seit August 2021 war die Inflationsrate bis zum Frühling 2022 immer nur gestiegen. Und in Grossbritannien liegt die Inflationsrate gar bei 10,1%.
Jährliche Inflationsrate in der Schweiz. Headline-Inflation umfasst alle Preise. Core-Inflation enthält alle Preise ausser Lebensmittel und Energie.
Ist die Zeit der Inflation bald wieder vorbei?
Dass die Preise in den USA seit August 2022 leicht senken, das halten Optimisten für einen Lichtblick. Sie glauben, die Inflation sei nur temporär – und schon bald wieder vorbei.
Die Optimisten stützen sich dabei auf die Tatsache, dass vor allem die Preise von Energie und Nahrungsmitteln besonders stark angestiegen sind. Beides Güter, die wegen des Krieges in der Ukraine derzeit knapper sind und weniger exportiert werden. Nach dem Ende des Krieges könnten sich, so die Optimisten, die Preise schnell wieder auf einem Normalmass einpendeln.
Doch damit könnten sie Unrecht haben. Denn ein knappes Angebot ist nur ein Faktor, der die Preise treiben kann.
Wie entsteht eigentlich Inflation?
In den Lehrbüchern für Volkswirtschaftslehre betrachten Ökonomen zur Inflation meist drei wesentliche Faktoren: Das Angebot, die Nachfrage und die Geldmenge.
Eine hohe Geldmenge ist eine Bedingung für Inflation. Nur wenn die Geldmenge gross genug ist, kann Inflation entstehen – immer dann, wenn der gesamtwirtschaftlichen Gütermenge eine zu grosse Geldmenge gegenübersteht. Diese Bedingung ist erfüllt: Die Geldmenge wurde massiv ausgeweitet. Wie das geschehen konnte, dazu später mehr.
Stellen wir eine hohe Geldmenge fest, dann betrachten wir als nächsten Faktor das Angebot. Wird das Angebot knapp, dann übersteigt die gesamtwirtschaftliche Güternachfrage das gesamtwirtschaftliche Güterangebot. Wenn das Angebot dann nicht plötzlich wachsen kann (Knappheit), aber genug Geld im System vorhanden ist (Geldmenge), dann steigen die Preise, die Inflation setzt ein.
Warum steigt die Inflation weiter?
Arbeitnehmer spüren beim Einkaufen, dass ihr Leben teurer wird, sie verlangen höhere Löhne. Bekommen sie, was sie fordern, können sie sich weiterhin so viel Konsum leisten wie vorher. Die Nachfrage bleibt weiterhin zu hoch.
Zahlen die Unternehmen jetzt höhere Löhne, dann sinkt ihr Gewinn. Wenn sie können, erhöhen sie deshalb die Preise. Die Konsumenten, die ja meist auch Arbeitnehmer sind, merken das und fordern höhere Löhne.
Alle – Arbeitnehmer wie Unternehmer – merken, dass alle Waren und Dienstleistungen ständig teurer werden. Darum warten sie nicht mehr mit dem Einkaufen. Sondern kaufen auch solche Dinge sofort, auf die sie sonst vielleicht noch ein paar Monate gewartet hätten. Denn: In ein paar Monaten werden diese Waren teurer sein. Das erhöht die Nachfrage. Das Angebot ist aber nicht gewachsen. Darum steigen die Preise.
Welche Dynamik wir in der Inflation auch betrachten: Überall sehen wir eine Spirale von Verhandlungen, in der die Preise nach oben geschaukelt werden. Niemand will verlieren, aber die Verhandlungen kosten viel Zeit, in der Nützlicheres gemacht werden könnte – und deshalb verlieren am Ende alle.
Wieso hat die Inflation nicht schon früher begonnen?
Wenn die Geldmenge steigt, dann kann Inflation entstehen – das haben wir eben gesehen. Aber warum ist dann Inflation nicht schon längst entstanden? Immerhin sorgen die Zentralbanken der westlichen Welt nicht erst seit gestern für eine Ausweitung der Geldmenge – sondern schon seit über einem Jahrzehnt.
Wie stark ist die Geldmenge in den USA gewachsen?
Die USA haben nach der Finanzkrise von 2008 mit einem Programm begonnen, das sich Quantitative Easing nennt. Am 25. November 2008 verkündet die US-Notenbank, dass sie bis zu 600 Milliarden Dollar hypothekenbesicherte Wertpapiere (englisch mortgage-backed securities, kurz MBS) kaufen werde. Das erste Programm QE 1 war befristet. Aber es wurde verlängert, 2010 mit QE2 und 2012 mit QE3. Anschliessend immer weitergeführt. Und im März 2020, rund um den Ausbruch der Pandemie, noch einmal als QE4 aufgestockt.
In den 14 Jahren seit Beginn des Programms ist die Bilanzsumme des Federal Reserve System von 925 Milliarden US-Dollar auf beinahe 9'000 Milliarden US-Dollar gewachsen – auf fast das Zehnfache.
Die Bilanzsumme der FED: Von 925 Milliarden US-Dollar im September 2008 auf 8’851 Milliarden im August 2022. Quelle: Federal Reserve Board.
Welche Länder haben die Geldmenge erhöht?
Nicht nur die USA haben die Geldmenge erhöht.
Ab 2010 stürzt Europa in eine Schuldenkrise. Die Europäische Zentralbank startet ein ähnliches Programm. Erst begrenzt begonnen, dann ausgeweitet, mit den Worten, mit denen Mario Draghi im Juli 2012 in die Geschichte eingegangen ist: «Whatever it takes.» Das Ergebnis: Auch hier fast eine Verzehnfachung der Bilanzsumme auf fast 8'800 Milliarden Euro bis im Mai 2022.
Die Schweiz macht bei den grossen Nachbarn mit, erhöht die Bilanzsumme im gleichen Zeitraum aber nur auf das Fünffache, von rund 200 Milliarden auf 1'000 Milliarden Franken.
Japan hat mit der Ausweitung schon viel früher begonnen. Die Spekulationsblase am japanischen Aktien- und Immobilienmarkt war Anfang der 90er-Jahre geplatzt. Bis 1999 hat man es dort mit einer Zinssenkung nach der anderen versucht. Dann war der Zins bei null angekommen – und Japan hat im grossen Stil mit Anleihenkäufen begonnen.
Wie erhöht man als Zentralbank die Geldmenge?
Alle Welt redet gern vom Gelddrucken. Aber es geht natürlich nicht um das Notengeld. Das sind die Instrumente:
1. Senkung der Leitzinsen. So senkt man als Zentralbank die Renditen für kurzlaufende Kredite. Etwa für Sparguthaben oder Geldmarktfonds. Die Folge: Bei Geschäftsbanken werden Kredite billiger für alle. Mit diesem Geld kann man dann Firmen übernehmen oder Immobilien kaufen. Die Geldmenge steigt, weil die Kredite im Geschäftsbankensystem zunehmen. In der Bilanz der Zentralbank sieht man diese erste Massnahme fast nicht (nur im Rahmen der Reserven, welche die Geschäftsbanken halten müssen. Bei der EZB aktuell 1 Prozent, bei der SNB 2,5 Prozent).
Auf die Zinsen für langfristige Anlagen wirkt diese erste Massnahme nicht unmittelbar. Dafür braucht es ausserdem:
2. Massive Anleihenkäufe. Hier kauft die Zentralbank Obligationen, oft die des eigenen Staates, im Rahmen von sogenannten Offenmarkt-Aktionen. Im Gegensatz zur ersten Massnahme sieht man diese Ausweitung in der Bilanz der Zentralbank sehr deutlich. Durch diese Anleihenkäufe monetarisiert die Nationalbank die Schulden des Staates: Das heisst ein Übermass an Schulden wird durch ein Übermass an Geld, quasi ein Übel durch ein anderes, ersetzt. Dabei ist es zwar verpönt, dass die Nationalbank Neuemissionen von Staatsobligationen direkt vom Finanzamt kauft, d.h. die Nationalbank kauft die Staatsobligationen am Sekundärmärkt von Dritten ab. Damit erhalten diese aber wieder Appetit, um bei den nächsten Neuemissionen des Staats mitzuzeichnen. Der Staat erhält so um die Ecke wieder neues Geld, das er ausgeben kann (für mehr Personal, für Infrastruktur, für Stimulus-Checks und Helikoptergeld). Ausserdem treibt die Zentralbank mit ihren Käufen den Preis der Obligationen. Das drückt die Rendite. So senkt die Zentralbank auch am langfristigen Ende die Zinsen.
(Mehr zum scheinbar paradoxen Zusammenhang zwischen dem Preis und dem Zins von Obligationen lesen Sie in unserem Beitrag: Obligationen in der Inflation: Plötzlich ist sicher nicht mehr sicher).
Kann man mit mehr Geld gegen jede Krise ankommen?
In den letzten Jahrzehnten haben Zentralbanken immer dann die Geldmenge erhöht, wenn es eine Krise gab. Zur Rettung haben sie dann folgende Aktionen unternommen:
1. Schlechte Kredite aufgekauft. Zu Beginn der ersten Runde im amerikanischen Quantitative Easing im Jahr 2008 ging es vor allem darum, den Markt nach dem Fall von Lehman Brothers zu stabilisieren. Die Kredite waren als Hypotheken bereits im Markt, zum Teil in äusserst fragwürdiger Bonität, man nannte diese Hypotheken Subprime. Die exzessive Geldmenge war im Geschäftsbankensystem bereits entstanden. Das FED hat nur verhindert, dass sie wieder verschwindet – dass die Kredite zusammenbrechen und die Liquidität austrocknet.
2. Neue Kredite ermutigt. Im März 2020, zu Beginn der Pandemie, hatten viele Bürger und Politiker darauf gehofft, die Europäische Zentralbank könne mit mehr Geld helfen. Doch nach der Staatsschuldenkrise hatte die EZB schon viele Jahre von Mario Draghis «Whatever it takes» hinter sich. Die Folge: Es gab kaum noch Anleihen im Markt, welche sie kaufen konnte, sie hatte schon alle. In einer denkwürdigen Rede sagt darum Christine Lagarde, sie könne nichts tun – die Verantwortung für einen Stimulus liege bei den Staaten: «I don’t think that anybody should expect any central bank to be the line of first response. It’s fiscal first and foremost.» Die Staaten haben gehandelt. Sie haben die Schuldenobergrenze gelockert. Sie haben neue Kredite aufgenommen. Und möglich gemacht, was jahrzehntelang verboten war: Dass in der EU die Gemeinschaft für Kredite bürgt – nicht mehr nur die einzelnen Länder. So konnten Hilfsgelder fliessen – und die EZB hat neue Staatsanleihen bekommen, die sie für ihre Bilanz kaufen konnte.
Zwei Beispiele, zwei Zentralbanken, zwei verschiedene Krisen. Und doch am Ende dasselbe Rezept. Mehr Geld löst jede Krise. Wer sich ans Lehrbuch hält, dürfte das nicht machen. Denn das, wie wir oben gesehen haben, sagt: Eine grössere Geldmenge bietet die Gefahr der Inflation.
Im ersten Fall hat das Federal Reserve Board einen Brand nicht gelöscht. Im zweiten Fall hat die Europäische Zentralbank gezielt Öl ins Feuer gegossen.
Aber hat das Lehrbuch vielleicht unrecht? Immerhin: Die Gefahr der Inflation besteht seit Jahrzehnten. Aber die Inflation ist sehr lange nicht gekommen – bis vor Kurzem.
Warum kommt die Inflation erst jetzt?
Die offiziellen Statistiken sagen, dass die Inflation gerade erst jetzt begonnen hat. Vorher war sie moderat, und ein bisschen Preissteigerung gilt als Preisstabilität – zwei Prozent gelten als normal (wie normal das wirklich ist, dazu unten mehr).
In Deutschland hat die Inflation die Zwei-Prozent-Marke erst im April 2021 gerissen. In den USA war es im März 2021 so weit: Zum ersten Mal seit Langem stand mit 2,6 Prozent eine 2 vor dem Komma.
Doch die offizielle Inflationsstatistik misst nur die Konsumentenpreise – nicht die Preise von Vermögenswerten. Die Marktwerte von Vermögenswerten wie Immobilien und Aktien jedoch sind seit dem Beginn des Quantitative Easing durchweg gestiegen. So einen Zustand steigender Vermögenspreise bei gleichzeitig stabilen Konsumentenpreisen nennt man heute auch Asset-Inflation.
Ist die Inflation für Assets nicht längst da?
Seit dem Ende der Finanzkrise gestiegen sind (fast) alle Anlageklassen, von Aktien über Immobilien bis hin zu Anleihen. Am 25. November 2008 hat die Geldschwemme mit QE1 begonnen. In den 10 Jahren vom 1. Dezember 2008 bis 1. Dezember 2018 haben seitdem zugelegt:
- Anleihen um 23 Prozent (US Treasury Index von 1'766 auf 2'171)
- Immobilien um 41 Prozent (Case Shiller Index von 150 auf 212)
- Aktien um 242 Prozent (S&P500 von 731 auf 2'506)
Sprich: Alles hat gewonnen. Auch Anlageklassen, die normalerweise als invers korreliert gelten, sind gleichzeitig gestiegen. Einzig Rohstoffe haben in diesem Jahrzehnt nicht wirklich performt (dafür dann umso mehr während der Ukraine-Krise). Der GSCI hat es mit sehr viel Schwankungen gerade mal auf 10 Prozent gebracht.
Besonders stark gewonnen haben Aktien. Denn die nominalen Zinsen auf Anleihen waren niedrig. Und so hiess es unter den Profis an der Wall Street: Es gibt keine Alternative zu Aktien. Dafür haben sie sogar ein eigenes Akronym geprägt: TINA – There Is No Alternative. Die Aktienpreise kannten vor allem eine Richtung: nach oben.
Warum sind die Konsumentenpreise lange Zeit nicht gestiegen?
Die Geldmenge wird immer grösser. Mit steigenden Aktienkursen und Immobilienpreisen wachsen die Privatvermögen. Wie kann es sein, dass dann die Konsumentenpreise lange nicht stiegen?
Kommen wir zurück zum Lehrbuch.
Eine grosse Geldmenge sorgt nur dafür, dass Inflation stattfinden kann – sie bedeutet nicht, dass die Inflation auch tatsächlich stattfinden wird. Damit die Preise steigen, muss noch immer ein zu kleines Angebot auf eine zu grosse Nachfrage treffen.
Die Nachfrage war gross. Neues Geld und hohe Vermögen haben sie angetrieben. Gleichzeitig ist aber auch das Angebot gewachsen – und das schon viel länger, nicht erst seit 2008. Das liegt von allem an zwei Gründen:
1. Die Technologie macht grosse Sprünge. Mit Software, Automation, Robotern und Künstlicher Intelligenz ist die Produktivität gestiegen. So konnte eine grössere Menge an Waren und Dienstleistung mit denselben Kosten entstehen. Der Preisdruck ist ausgeblieben. Auch deshalb, weil heute oft Roboter und Algorithmen die Arbeit erledigen, die vorher von Menschen gemacht wurde.
2. Die Globalisierung bringt billige Arbeitskräfte. Seit der Öffnung des kommunistischen China zum Kapitalismus ist das Land zur Werkbank der Welt geworden. Und was nicht in China produziert wird, kommt aus Vietnam, Indonesien, Bangladesch und vielen weiteren Ländern. Immer gab es ein neues Land, dessen Arbeitskräfte einer immer globaleren Wirtschaft zu Dienste stehen. So sind die Löhne zwar in einzelnen Ländern gestiegen – aber global im Ganzen real sogar gesunken.
Das hat die Konsumentenpreise lange gebremst. Gestiegen sind nur die Assetpreise. Aber müssten nicht wenigstens die Mieten steigen, wenn die Immobilienpreise steigen?
Aber warum beginnt Inflation gerade jetzt?
Im Mai 2022 sah die Welt so aus: Die Arbeitslosigkeit ist tief. Fast jeder, der will, hat einen Job. Aus Kriegsgebieten kommen weder Weizen noch Öl. Und wegen neuen Lockdowns auch weniger Velos und Smartphones aus China. Das wären die Zutaten für eine Angebotsinflation, die von selber abklänge.
Problematischer ist, dass die Wirtschaft boomt – und deswegen Vollbeschäftigung herrscht. Die meisten von uns werden das nicht gerne hören. Aber Vollbeschäftigung ist der Feind der Preisstabilität. So lange es für jeden Job auch jemand anderes gäbe, der ihn gerne machen würde, so lange gibt es keine Inflation. Wenn Arbeitnehmer jedoch rar werden und mit Handkuss den Job wechseln können, und nach einem Wechsel vielleicht 20 Prozent mehr verdienen, dann ist die Inflation nicht aufzuhalten.
Liegt die Inflation nicht nur an den Problemen in der Lieferkette, sondern mindestens zum Teil an der heissgelaufenen Konjunktur, dann kann nur eine Rezession sie wieder stoppen.
Wie beendet man eine Inflation?
Einfache Antwort: mit harten Mitteln. Die Zentralbank kann eine Inflation beenden, in dem sie die Zinsen erhöht und ihre Bilanzsumme verkleinert. Im Gegensatz zum Ausweiten der Geldmenge ist das sogar einfach.
Der legendäre britische Ökonom John Maynard Keynes hat darüber gesagt: «Man kann ein Pferd zur Tränke führen, saufen muss es schon selbst.» Nur wenn private Haushalte und Unternehmer die Kredite haben wollen, kann das Geschäftsbankensystem Geld schaffen. Und nur wenn Staaten es ausgeben, können die Zentralbanken es drucken.
Hart bremsen dagegen kann eine Zentralbank ganz allein, ohne fremde Hilfe. Und: Hart bremsen ist leichter als beschleunigen. Wie ein Chauffeur, der bremsen muss, wird sie dabei allerdings vermutlich behutsam vorgehen – langsamer, als sie könnte.
Seit FED-Governor Alan Greenspan kann man dabei folgendes Muster beobachten: Die Zentralbank wird so lange in sehr kleinen Schritten die Zinsen erhöhen, bis etwas ein kleines bisschen kaputtgeht. Ist die Rezession dann da, wird sie möglicherweise gleich wieder mit dem Senken beginnen.
Ist die Zentralbank zu vorsichtig, kann sie das Leiden allerdings in die Länge ziehen. Und das ist meist die komplizierte Antwort auf die Frage, wie man eine Inflation beendet. In den Siebzigerjahren hat es in den USA zwei Rezessionen und in der Folge vier Jahre ohne Wachstum, aber galoppierender Inflation gegeben – die Kombination von Stagnation und Inflation, die wir heute unter dem Schlagwort Stagflation kennen.
Diese Phase hat erst ein Ende gefunden, als 1979 Fed-Präsident Paul Volcker die Leitzinsen angehoben hat – und ein ganzes Paket weiter harter Massnahmen beschlossen. Wir kennen dieses Paket heute als Volcker-Shock. Und ein Schock war es tatsächlich: Die Hypozinsen stiegen auf 18 Prozent.
Ist Inflation heute erwünscht?
Der Auftrag an die Zentralbanken ist klar. Bei fast allen Zentralbanken der Welt steht Preisstabilität im Mandat. Bei manchen gehört ausserdem ausdrücklich auch zum Auftrag, dass sie die Bedingungen für Vollbeschäftigung schaffen sollen – so etwa bei der US-Notenbank FED.
Um nach der Finanzkrise von 2008 wieder Vollbeschäftigung zu erreichen, hat das Federal Reserve Board seitdem ein Inflationsziel von 2 Prozent angestrebt. Inflation ist zu einem Ziel geworden, das man öffentlich aussprechen kann – und sogar erreichen will.
Seither haben bei öffentlichen Auftritten die Präsidenten des FED, von Ben Bernanke über Janet Yellen bis hin zu Jerome Powell, sogar bedauert, sie hätten dieses Inflationsziel unterschritten. Im Klartext haben sie damit gesagt: Wir müssten eigentlich noch mehr Geld drucken, als wir es schon tun. Und wir können das auch gefahrlos tun.
Kann man Inflation kontrollieren?
Ein bisschen Inflation wollten in den letzten Jahren alle. Was allerdings niemand wirklich wollen kann, das ist eine Situation wie bei Goethe. «Die ich rief, die Geister, werd ich nun nicht los», klagt sein Zauberlehrling in der Ballade von 1797, während die Geister das Haus unter Wasser setzen.
Genau das kann mit Inflation passieren.
In der Geschichte gibt es mehre Bespiele, in denen eine Inflation aus dem Ruder lief. Der spektakulärste Fall in Mitteleuropa ist die Hyperinflation der Weimarer Republik. Begonnen hat die Inflation mit dem Ersten Weltkrieg 1914. Erst langsam, dann immer schneller – bis der Wertverfall im Jahr 1923 dann absurde Züge angenommen hat.

Hundert Billionen Mark. Das klingt nach sehr, sehr viel Geld. Mitte November 1923 konnte man dafür allerdings in Deutschland gerade noch vier Laib Roggenbrot kaufen. Die Inflation fand erst ein Ende, als am 15. November eine neue Währung eingeführt wurde: Die Rentenmark. Mit der wurde aus 100 Billionen Reichsmark 1 Rentenmark.
Für weitere Beispiele müssen wir nicht 100 Jahre zurückschauen. Hyperinflationen gab es immer wieder. Zu den jüngeren Beispielen von Hyperinflation gehören Venezuela (2019), Zimbabwe (2008) und Jugoslawien (1994) – hier sind die alten Währungen zusammengebrochen und mussten durch neue ersetzt werden.
Um der Inflation Einhalt zu gebieten, greifen viele Länder auch dann zu einer Währungsreform, wenn sie noch gar keine Hyperinflation haben. Argentinien und die Türkei haben beide jahrzehntelange Inflationen von 10 bis 30 Prozent jährlich erlebt, beide haben neue Währungen eingeführt.
Der Erfolg dieser Währungsreformen war allerdings sehr vergänglich. Schnell hatte sich die Inflation wieder bei den alten Werten eingependelt. Die Menschen im Land hatten sich an Inflation gewöhnt. Das Vertrauen in die eigene Währung blieb niedrig. Und wer konnte, hat so schnell wie möglich sein Geld in harte Währungen gewechselt, vorzugsweise in US-Dollar oder in Euro.
Wer kann sich harte Massnahmen leisten?
Einer der wenigen Fälle, bei denen eine Zentralbank das Vertrauen nachhaltig wiederhergestellt hat, waren am Ende der Siebzigerjahre in den USA – mit dem Volcker-Schock. Der Dollar findet zu seiner alten Stärke zurück und bleibt die Leitwährung der Welt.
Der Preis dafür: Hypothekenzinsen von 18 Prozent. Die Leitzinsen hat das FED 1979 steil erhöht auf 17.6 Prozent. Bis 1981 sind sie noch weiter angezogen, bis auf 22.36 Prozent.
Wenn das allerdings die Lösung sein soll, dann fragt sich: Könnten die USA nach so einer Zinserhöhung die Zinsen auf ihre Schulden noch bezahlen?
Ende 2021 lag der Saldo der Bundesschulden über 28'000 Milliarden Dollar. Bei 20 Prozent Zinsen bedeutet das angenommen eine Zinslast von 5'600 Milliarden Dollar – fast genauso viel, wie die Regierung im Jahr 2021 überhaupt ausgegeben hat (6'800 Milliarden).
Alle staatlichen Leistungen einstellen, alle Staatsangestellten entlassen – nur um stattdessen Schulden zu zahlen? Unwahrscheinlich, dass demokratisch gewählte Politiker zu solchen Mitteln greifen wollen.
Eine Lösung wie damals in der Weimarer Republik scheint eher denkbar: Durch die Hyperinflation hat vor allem der Staat profitiert. Seine Schulden beliefen sich 1923 auf 154 Milliarden Mark. Als am 15. November 1923 die neue Währung Rentenmark eingeführt wurde, waren das gerade noch 15,4 Pfennige. Die eigenen Schulden hat der Staat so abgeschafft. Von Vermietern, deren Hypothekenschulden wertlos verfallen sind, hat sich der Staat den Vermögensgewinn im Rahmen der Hauszinssteuer zurückgeholt.
In der Weimarer Republik waren es vor allem die Kosten des Ersten Weltkrieges, die als Schulden auf den Büchern des Staates standen. In den letzten 20 Jahren unserer Zeit haben ganz verschiedene Massnahmen zu mehr Schulden geführt – von Bankenrettungen bis hin zu Lohnersatz für alle, die wegen Corona nicht arbeiten konnten. Doch egal, wofür der Staat das Geld ausgibt – irgendwann muss irgendwer zahlen.
Kann man nicht einfach weiter Geld drucken?
Langfristig betrachtet ist Inflation immer ein monetäres Problem. Das ist das Credo des Monetarismus, einer Schule von Ökonomen rund um Nobelpreisträger Milton Friedman. Andere Ökonomen stellen langfristige Betrachtungen lieber in den Hintergrund. «In the long run we’re all dead» – langfristig betrachtet sind wir alle tot, hat John Maynard Keynes gespottet. Keynes war dreimal für den Nobelpreis nominiert. Er hat ihn zwar nie bekommen – und doch heisst heute eine ganze Schule von Ökonomen nach ihm: Keynesianismus.
In den letzten Jahrzehnten galt das Credo der Monetaristen geld- und wirtschaftspolitisch als Tabu. En vogue waren die Ideen der Keynesianer. Vor allem in der neuesten Ausprägung: der Modern Monetary Theory. Die sagt zum Thema Gelddrucken: Yes, we can!
Die US-Wirtschaftswissenschaftlerin Stephanie Kelton macht das im Jahr 2020 sogar zum Thema eines ganzen Buches: «The Deficit Myth: Modern Monetary Theory and the Birth of the People's Economy». Darin begründet sie, warum jeder Staat, der Herr über seine eigene Währung ist, im Grunde so viel Geld drucken kann, wie er will. Und darum könne der Staat auch so viel Geld ausgeben, wie er eben für richtig hält – und solange es demokratisch ein Mandat dafür gibt.
Ein Hindernis, das selbst Kelton selber zugibt: Lohninflation. Die war im 2020 jedoch noch nicht in Sicht. Und deswegen konnte Kelton schlussfolgern: Solange noch Menschen ohne Arbeit sind, können die Menschen mit Job keine besseren Löhne verlangen. Und ohne Lohndruck gibt es keine Inflation – egal, wie gross die Geldmenge auch werden sollte.
Nur: Im Juli 2022 liegt die Arbeitslosenrate in den USA bei nur noch 3.5 Prozent. Viele Ökonomen sagen: Tiefer kann sie nicht sinken. Das ist Vollbeschäftigung. Denn ein Teil der Arbeitnehmer sei immer gerade zwischen zwei Jobs. Diese Sucharbeitslosigkeit gilt als Sockel, die meisten Ökonomen schätzen sie auf rund 4 Prozent. Und man muss nicht nur die Ökonomen fragen, ob in den USA Vollbeschäftigung herrscht. Viele Beschäftigte machen sogar zwei Jobs. Schon allein deshalb, weil der Lohn aus einer Vollzeitstelle zum Leben nicht reicht.
Und auch ein anderes Problem löst die Modern Monetary Theorie nicht: Nicht alle Staaten sind Herr ihrer eigenen Währung. Die Länder der Eurozone haben ihre Souveränität abgegeben an die Europäische Zentralbank. Von ihr bekommen die 19 Staaten der Eurozone eine einheitliche Geldpolitik – machen aber weiterhin 19 verschiedene Budgets.
Zusammengefasst: Wenn ein Land nicht Herr seiner eigenen Währung ist, kann es nicht unbegrenzt Geld drucken. Und spätestens, wenn Vollbeschäftigung erreicht ist, muss auch ein souveränes Land aufhören mit dem Geld drucken. Sonst geht, was kurzfristig zu funktionieren scheint, langfristig schief.
Wer wird das bezahlen?
Für eine langfristige Perspektive wechseln wir besser zu Milton Friedman. Dann wird vieles klar. Der Staat kann vielleicht kurzfristig mehr ausgeben, als er einnimmt. Aber langfristig muss er entweder Steuern erhöhen oder Geld drucken.
Ob im linken Lager oder im rechten – Geld drucken ist für Politiker am einfachsten. In einer legendären Rede von 1978 sagt Friedman auf die Frage danach, wer überbordende Staatsausgaben zahlt:
«Do you suppose the tooth fairy does? You pay it and I pay it, and one of the ways we pay it is by the tax which we call inflation. Inflation is from this point of view a form of taxation.»
Also übersetzt:
«Glauben Sie, die Zahnfee tut das? Sie zahlen sie und ich zahle sie, und eine der Arten, wie wir sie zahlen, ist die Steuer, die wir Inflation nennen. Aus dieser Sicht ist die Inflation eine Form der Besteuerung.»
—Milton Friedman, Nobelpreisträger für Ökonomie
Wird das Defizit mit Steuern beglichen, dann behält der Staat seinen politischen Gestaltungsspielraum. Wir alle haben uns daran gewöhnt, dass die Einkommenssteuer progressiv ist. Das heisst: Wer mehr verdient, zahlt überproportional mehr Steuern. Das ist politisch so gewollt, denn mit einem höheren Einkommen kann man sich höhere Steuersätze leisten. Der Staat könnte mit Sondersteuern grosse Vermögen besteuern.
Nimmt der Staat hingegen Inflation in Kauf, um seine Schulden zu tilgen, dann trifft das alle. Sie trifft die Wohlhabenden und nagt an ihren Vermögen. Sie trifft aber auch diejenigen, die am Rande des Existenzminimums leben – und sonst gar keine Steuern zahlen.
Welche anderen Steuern gibt es noch?
Steuern im engeren Sinne und Inflation als Steuer – das sind nur zwei der Möglichkeiten, um Staatsausgaben zu finanzieren. Die US-amerikanische Wirtschaftswissenschaftlerin Carmen Reinhart, Vizepräsidentin und Chefökonomin der Weltbank, nennt vier weitere Methoden:
- Zinssätze auf Staatsschulden werden nach oben beschränkt.
- Verstaatlichung von Banken. Und Verhinderung des Marktzutritts für andere Banken.
- Nationale Banken müssen Anleihen des eigenen Staates kaufen oder als Reserven halten.
- Kontrolle des Kapitalverkehrs.
Die erste Methode kommt derzeit in westlichen Ländern zum Einsatz. Alle weiteren nicht. Sie sind aber weltweit beliebt in Ländern, wo Inflation aus dem Ruder zu laufen droht. Diese Massnahmen gehören zum Arsenal dessen, was Reinhart und vor ihr auch schon die US-Ökonomen Edward S. Shaw und Ronald McKinnon financial repression nennen – ein Arsenal an Massnahmen, mit denen Staaten Geld von Privaten in ihre Taschen umleiten können.
Wie können Sie Ihr Vermögen schützen?
Nur wenige Menschen haben in der Inflation ihr Vermögen vermehrt. Der Deutsche Hugo Stinnes ist sogar richtig reich geworden. Während der Hyperinflation der Weimarer Republik verschuldete er sich in Reichsmark und investierte in harte Währungen. Eine riskante Strategie – für ihn ist sie aufgegangen. Es gibt keine Garantie, dass man das heute wiederholen kann. Vor allem, weil derzeit fast alle harten Währungen gleichzeitig in die Inflationsphase eintreten.
Für die meisten von uns heisst es: Schaden abwenden. Suchen Sie in Zeiten hoher Inflation daher nicht gezielt nach mehr Rendite. Aber halten Sie sich vielleicht ein wenig weiter entfernt von den Vehikeln, mit denen Staaten ihre Schulden finanzieren – den Obligationen.
Warum Obligationen in der Inflation problematisch sind, dazu lesen Sie am besten diesen Beitrag: Obligationen in der Inflation: Plötzlich ist sicher nicht mehr sicher. Wie Real Assets Ihr Portfolio besser schützen und wie Sie den Anteil in Ihrem Portfolio bei True Wealth erhöhen, das lesen Sie hier: Inflation: Mit Real Assets das Vermögen schützen.
Über den Autor

Gründer und CEO True Wealth. Nach seinem ETH-Abschluss als Physiker war Felix erst mehrere Jahre in der Schweizer Industrie und darauf vier Jahre bei einer grossen Rückversicherung im Portfoliomanagement und in der Risikomodellierung tätig.
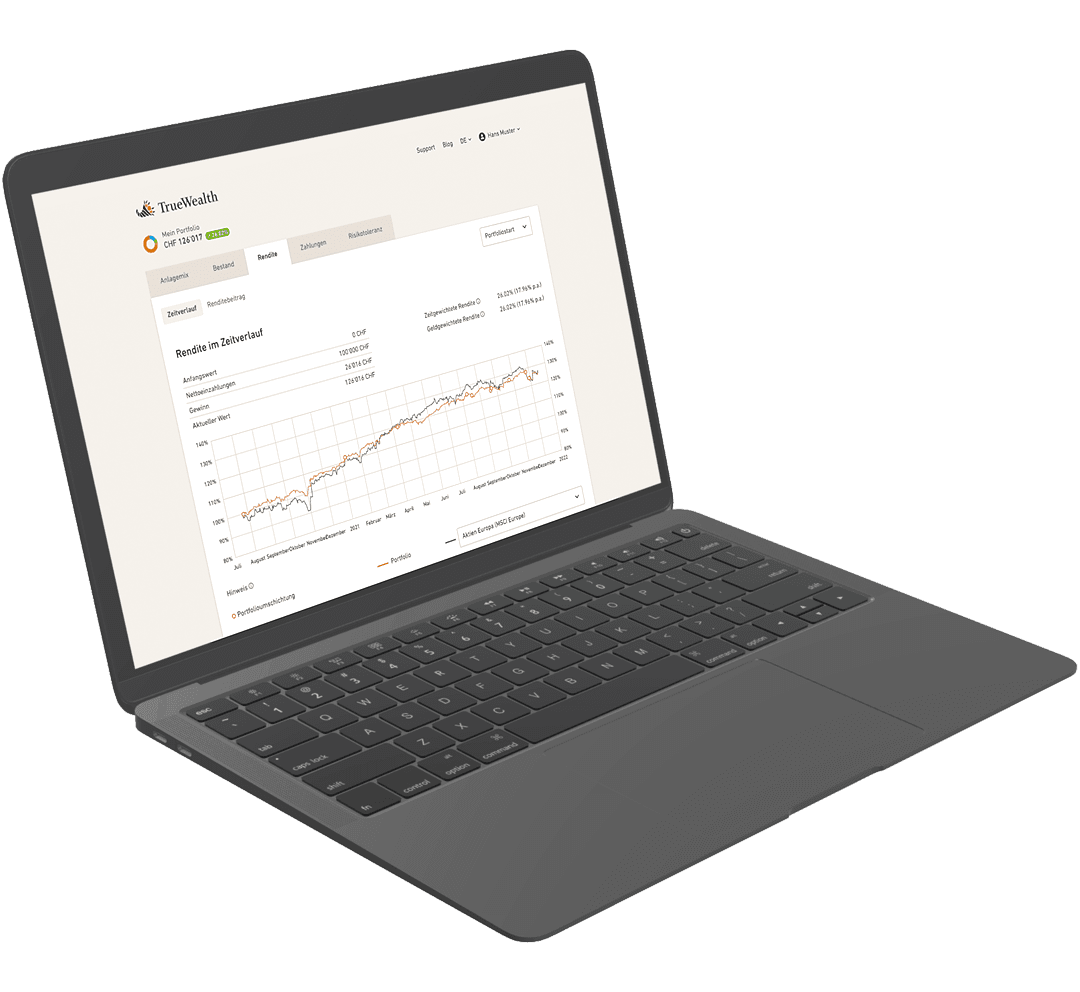
Bereit zu investieren?
Konto eröffnenSie wissen nicht, wo Sie anfangen sollen? Eröffnen Sie jetzt ein Testkonto und wandeln Sie es später in ein echtes Konto um.
Testkonto eröffnen